Der im Schulfeld gebräuchliche Ausdruck Kompetenz verbindet Wissen und mögliches Handeln mit dem Ziel, gegenwärtige und zukünftige Lebenssituationen bewältigen und gestalten zu können. Diesbezüglich müssen kompetente Menschen sich darauf »verstehen«,
(a) wie sie ihre Bildung und das mit dieser verbundene Können kreativ nutzen,
(b) wie sie lebenspraktische Erfahrungen verarbeiten, bewerten und weiterlernen,
(c) wie sie mit ihren Gefühlen und Emotionen umgehen,
(d) wie sie Probleme sach- und sozialkompetent lösen und
(e) wie sie Aufgaben allein und zusammen lernkompetent bearbeiten können.
(vgl. ThILLM 2010)
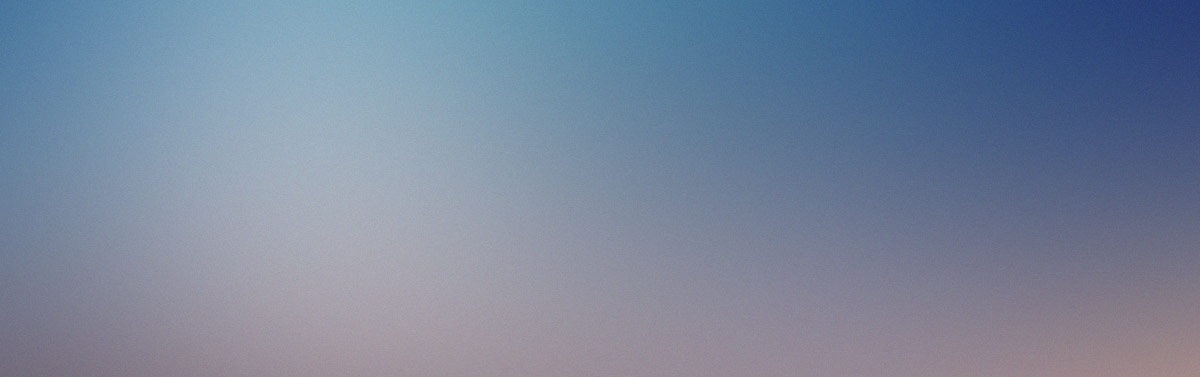
Das Kompetenzmodell
Das Kompetenzmodell, das dem Thüringer Lehrplan zugrunde liegt,
beruht auf einer Dreiecksbeziehung verschiedener Kompetenzen.
Die Selbstkompetenz, die Sozialkompetenz und die Methodenkompetenz
stehen in einer wechselseitigen Beziehung zueinander.
[?]
Die erlernten Kompetenzen dienen dabei auf einem abstrakten, übergeordneten Niveau der Bearbeitung von unbekannten oder unerwarteten Problemen. Der Schüler wird nicht mehr auf spezielle Ereignisse vorbereitet, sondern soll sich selbst und anderen durch den Kompetenzerwerb in Problemsituationen behilflich sein können. Diese "überfachlichen Kompetenzen" dienen dabei der "Bewältigung von Lebenspraxis" [?].
Die Schule soll dabei die Möglichkeit für "erfahrungsorientiertes Lernen" bieten. Sie ist ein Ort, um gemeinsam mit anderen zu Lernen, eigene Erfahrungen beizutragen, von anderen Hinweisen zu profitieren und dadurch gemeinsam zu Problemlösungen zu finden. Der Schüler soll angeregt werden, sich selbst einschätzen und motivieren zu können, um sich auf Grundlage der Lerngelegenheiten eigenständig weiterzubilden [?].
Planen, Gestalten, Bewerten
Die dem Kompetenzmodell zugrunde liegende Lernstruktur soll auch ihren Weg in die Durchführung des Minecraftprojektes finden. Die drei Phasen seien im Folgenden exemplarisch beschrieben:
1. Planungsphase:
Den Schülern wird vorbereitend eine Aufgabe gestellt zu der sie mögliche Lösungsansätze entwickeln. Nicht jeder Einfall führt zum Ziel oder ist der vorgegebenen Zeit zu schaffen. Dabei gehen bereits gesammelte Erfahrungen in die Lösungsfindung mit ein. Teilweise sind mehrere Varianten zielführend und die Gruppen verwenden unterschiedliche Wege.
2. Gestaltungsphase:
Die Schüler wählen die für sie am besten erscheinende Methode aus und arbeiten nun selbstständig bzw. in der Gruppe an der Aufgabenstellung. Vor allem im Team muss eine gemeinsame Strategie geplant und umgesetzt werden. Jeder braucht eigene Aufgaben und will gleichberechtigt an der Lösung beteiligt sein. Die Schüler müssen entsprechend miteinander kommunizieren, um im geplanten Zeitrahmen zu einem guten Ergebnis zu gelangen.Bei Problemen in der Bewältigung der Aufgabenstellung müssen die Schüler ihre Motivation aufrecht erhalten und das Ziel im Auge behalten. Fehler sind dabei im Lernprozess ebenso wichtig wie Erfolge, da die Erfahrungen in zukünftige Arbeitsprozesse mit eingehen. Weitere Recherchen und Alternativen gegenüber der geplanten Lösungsstrategie führen näher an das Ziel heran. Der Lehrer kann dabei durch Anregungen oder Tipps unterstützen.
3. Bewertungsphase:
In der Nachbereitungsphase stellen die Schüler ihre Arbeitsergebnisse vor. Sie reflektieren ihre Erfahrungen und beurteilen ihren Lösungsweg. Dabei sollen sie auch einschätzen, ob ihr Lernprozess verbesserungswürdig ist, wie beispielsweise durch bessere Vorbereitungen und Absprachen oder anderer Lösungswege. Die Mitschüler können sich hierbei durch Kritik und Anregungen beteiligen. Sie tauschen dadurch Erfahrungen aus und können diesen lernen.
Zusammenfassung
Jede Inhaltseinheit endet mit einer Zusammenfassung des Erreichten. Diese wird mglichst schriftlich festgehalten und dient später auch einem Rückblick über das Projekt.Einblicke in das Projekt
Das Projekt basiert auf mehreren speziellen Einzelkarten, die
für unterschiedliche Zielstellungen vorbereitet sind. Zunächst
werden diese in drei Bereiche untergliedert.
 Die Einführungswelt dient dem Kennenlernen der grundlegenden
Steuerung sowie den Funktionsweisen des Programms.
Die Einführungswelt dient dem Kennenlernen der grundlegenden
Steuerung sowie den Funktionsweisen des Programms.
Auf der freien Karte erstellen die Schüler eine Siedlung nach ihren eigenen Vorstellungen. Sie handeln gemeinsame Regeln und Zielstellungen aus. Neben der Planung der Arbeit und der nötigen Rollenverteilung arbeiten die Kinder in Gruppen oder selbstständig an der Umsetzung besprochener Inhalte. Immer wieder müssen Kompromisse gefunden und Vereinbarungen neu ausgehandelt werden. So verbindet sich die virtuelle Welt mit den realen Elementen.
Einige speziell vorbereitete Aufgaben sind im Lernzentrum zu bewältigen. Dieses befindet sich auf einen zusätzlichen Karte und kann neben der Siedlungs-Welt nach Bedarf weiterentwickelt werden. Einige Beispiele hierzu sind in der folgenden Übersicht näher erläutert.

Siedlung
Im Bereich der Siedlung geht es primär um das kooperative Bauen und Aushandeln von Regeln.

Lernzentrum
Das Lernzentrum besteht aus mehreren Hallen, die je nach Bedarf eingerichtet werden.

Portal
Die großen Hallen sind teilweise weit entfernt. Damit sich keiner verläuft, wird dorthin teleportiert.

Geometrie
Eine der Hallen steht unter geometrischem Schwerpunkt.

Beispiel 1
In der Mitte befindet sich ein farbiges "Gebäude". Zeichne die verschiedenen Ansichten!

Beispiel 2
Zeichne den Bauplan für die verschiedenen Gebäude.

Beispiel 3
Werde selbst kreativ. Baue Gebäude und lasse sie von Mitschülern zeichnen.

Beispiel 4
Spiegele die Figuren an den markierten Achsen.

Landkarten
In einer weiteren Halle ist eine kleine Siedlung vorbereitet.

Orientierung
Zeichne eine Karte! Die Länge eines Würfels entspricht einem Zentimeter auf dem Papier.
Beispiel: Kartenarbeit
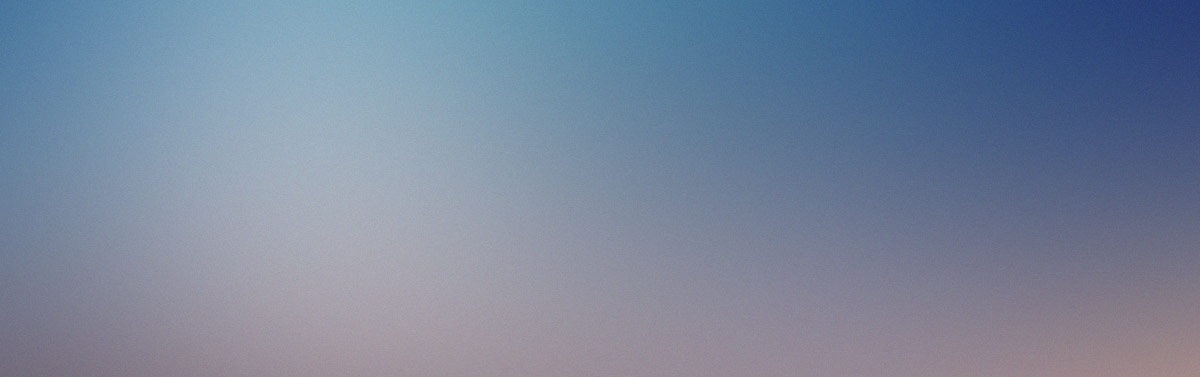
Der Vorteil des Spiels für die Nutzung im Rahmen der Kartenarbeit besteht darin, dass das Spiel grundlegend auf quadratischen Flächen beruht. Während in der realen Umwelt immer wieder Unregelmäßigkeiten, wie schräg angelegte Beete, Wege oder Grundstücksgrenzen auftreten, hilft der gleichmäßige Aufbau bei der Orientierung während der Arbeit. Die Schüler können sich problemlos um und auf dem Gelände bewegen sowie die Siedlung von allen Seiten nach Bedarf betrachten.
In einer Lernhalle befindet sich eine kleine vorbereitete Siedlung. Zu sehen sind dort der Hauptweg, Häuser, Felder, Tiere und Bäume. Die Aufgabe der Kinder ist es nun, eine Übersichtskarte dieser Siedlung anzufertigen. Je nach Ermessen des Lehrers kann dies verschieden umfangreich gestaltet werden:
Im kleinen Umfang reicht es aus, den Weg, die Gebäude und die Grünflächen einzuzeichnen. Beim umfangreicheren Gestalten können noch Zeichen für Getreide und Tiere vereinbart werden. Außerdem haben die verschiedenen Gebäude jeweils andere "Industrien" beherbergt, sodass auch dort Zeichen eingetragen oder Beschriftungen verwendet werden können. Für die Karten eignen sich karierte Blätter, auf denen für jedes Kästchen / jeden Zentimeter ein Block gezeichnet werden kann.